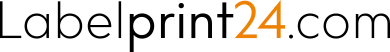GHS-Gefahrensymbole: Welches Symbol kennzeichnet Gefahrstoffe?
Title h1
Type your text
Title h11111
Die Logistik ist geprägt von der ständigen Herausforderung, Güter effizient, sicher und wirtschaftlich zu transportieren. Dabei spielt der Begriff "Gebinde" eine zentrale Rolle, denn er steht für die Zusammenfassung einzelner Waren zu einer Einheit, die den Transport- und Lagerprozess erheblich erleichtert. Doch was genau versteht man unter einem Gebinde, wie wird es eingesetzt, und warum ist es in der Logistik sowie in anderen Branchen unverzichtbar? Im Folgenden erhalten Sie eine ausführliche Erläuterung zu diesem Thema.

Was ist ein Gebinde?
Definition und Beispiele
Ein Gebinde ist ein Sammelbegriff für eine oder mehrere Waren, die zu einer handhabbaren Einheit zusammengefasst werden. Diese Einheit dient der Optimierung und Vereinfachung von Transport-, Lager- und Verarbeitungsprozessen. Dabei kann ein Gebinde aus verschiedenen Verpackungen wie Kartons, Kisten, Paletten, Containern oder speziellen Behältnissen bestehen. Je nach Kontext und Branche kann sich die Bedeutung des Begriffs leicht unterscheiden.
In der Logistik gibt es zwei Hauptarten von Gebinden:
- Befüllte Verpackung: Diese Variante umfasst die Ware und ihre Verpackung als Einheit, z. B. eine Palette mit verpackten Kartons.
- Leere Verpackung: Hierbei handelt es sich um Behältnisse ohne Inhalt, wie leere Kartons oder Paletten.
Historische und sprachliche Wurzeln
Die Herkunft des Begriffs "Gebinde" deutet bereits auf dessen Bedeutung hin: Es handelt sich um etwas Zusammengebundenes, also eine Zusammenstellung mehrerer gleichartiger oder zusammengehöriger Einheiten. Ursprünglich wurde der Begriff vor allem in der Textilbranche verwendet, um mehrere Fäden oder Stoffstücke als eine Einheit zu bezeichnen. In der Getränkebranche fand der Begriff ebenfalls Anwendung – so bezeichnete man früher mehrere Flaschen, die mit Schnüren verbunden waren, als Gebinde. Auch heute wird der Begriff dort genutzt, beispielsweise für Bierkästen, Weinfässer oder Sixpacks.
Bedeutung von Gebinden in der Logistik
Die moderne Logistik ist auf maximale Effizienz ausgelegt, um Kosten zu reduzieren, Zeit zu sparen und die Prozesse zu optimieren. Hier kommen Gebinde ins Spiel, denn sie erleichtern die Handhabung großer Warenmengen, indem sie diese in sinnvolle, transportfähige Einheiten unterteilen.

Vorteile von Gebinden
Gebinde bieten zahlreiche Vorteile:
- Effiziente Handhabung: Einzelne Waren werden gebündelt, wodurch sie leichter sicher zu transportieren, zu lagern und zu zählen sind. Ein Beispiel: Anstatt eine Million Schrauben einzeln zu bewegen, fasst man diese in kleinen Schachteln (Kleingebinde), Kartons und schließlich auf Paletten (Großgebinde) zusammen.
- Zeitersparnis: Das Be- und Entladen von Lkws, Schiffen oder anderen Transportmitteln erfolgt schneller, da größere Einheiten bewegt werden.
- Nachverfolgbarkeit und Übersichtlichkeit: Gebinde ermöglichen eine genaue Mengenberechnung und erleichtern die Kontrolle des Warenflusses.
- Schutz der Waren: Verpackte Gebinde schützen die Produkte vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Beschädigungen oder Verunreinigungen.
Anwendungsbeispiel: Schraubentransport
Stellen Sie sich vor, eine Million Schrauben müssen vom Hersteller zum Kunden transportiert werden. Ohne Gebinde würde dies erhebliche Probleme bereiten:
- Es wäre unpraktisch, jede Schraube einzeln zu verpacken oder zu bewegen.
- Die benötigte Zeit und die Ressourcen für Transport und Lagerung wären enorm.
- Die Übersicht über die Menge der Schrauben ginge verloren.
Um dies zu vermeiden, fasst der Hersteller die Schrauben zunächst in kleinen Schachteln (Kleingebinden) zusammen. Diese Schachteln werden dann in größere Kartons verpackt, die wiederum auf Paletten gestapelt werden. So entsteht eine hierarchische Struktur aus mehreren Gebinde-Ebenen, die eine effiziente Handhabung ermöglicht.


Gebinde in der Praxis: Branchenübergreifende Relevanz
Der Begriff Gebinde wird nicht nur in der Logistik, sondern auch in verschiedenen Branchen verwendet:
- Lebensmittelindustrie: Hier dienen Gebinde zur Verpackung und zum Transport verderblicher Waren wie Obst, Gemüse oder Getränke. Beispiele sind Getränkekästen, Schrumpffolien-Sixpacks oder Obstkisten.
- Chemieindustrie: Gebinde wie Fässer, IBC-Container oder Spezialflaschen gewährleisten die sichere Lagerung und den Transport chemischer Substanzen.
- Floristik: In der Floristik bezeichnet ein Gebinde die ästhetische Zusammenstellung von Blumen und Pflanzen, beispielsweise für Hochzeiten oder Trauerfeiern.
Abgrenzung zu anderen Begriffen in der Logistik
In der Logistik gibt es einige Begriffe, die häufig synonym verwendet werden, jedoch unterschiedliche Bedeutungen haben. Hier die wichtigsten Unterschiede:
- Stückgut: Einzelne Waren oder Produkte, die unabhängig voneinander transportiert werden können. Im Gegensatz dazu umfasst ein Gebinde mehrere Produkte als Einheit.
- Collo (Pl. Colli): Eine einzelne Verpackungseinheit, die ein Gebinde oder Stückgut enthalten kann. Beispiele sind Kartons, Behälter oder Paletten.
- Sammelgut: Eine Sammlung von Waren, die von unterschiedlichen Absendern stammen und zu einem gemeinsamen Ziel transportiert werden. Sammelgut kann sowohl aus Stückgut als auch aus Gebinden bestehen.
Wie groß sollte ein Gebinde sein?
Die richtige Gebinde-Größe hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Zielgruppe und handelsübliche Mengen: Endverbraucher benötigen kleinere Gebinde als Großabnehmer, z. B. Restaurants.
- Handhabung: Gebinde sollten einfach transportierbar sein. Ein Beispiel sind Kunststoffflaschen, die zu Sixpacks zusammengefasst werden, um Stabilität und Stapelbarkeit zu gewährleisten.
- Gewicht und Tragfähigkeit: Das Gewicht eines Gebindes darf die Tragkraft der verwendeten Transportverpackung und Transportmittel nicht überschreiten. So kann eine Europalette zwar bis zu 2.000 kg tragen, doch auch die Belastbarkeit der einzelnen Gebinde innerhalb des Stapels muss berücksichtigt werden.
- Transportart: Je nach Transportziel – vom Hersteller zum Händler oder in den Verkaufsraum – können unterschiedliche Gebindearten und -größen erforderlich sein.
- Optimierung der Gebinde-Größe: Die ideale Gebinde-Größe ergibt sich aus der Anzahl der notwendigen „Gebinde-Ebenen“, der Art der Verpackung und der Materialauswahl. Ein durchdachter Einsatz von Gebinden sorgt dafür, dass Prozesse effizienter ablaufen und Produkte einfacher zu handhaben sind.
Effizienz durch Gebinde: Optimierung und Berechnung
Der Einsatz von Gebinden zielt darauf ab, die Wirtschaftlichkeit von Transportprozessen zu maximieren. Dies umfasst:
- Optimale Raumausnutzung: Durch die geschickte Zusammenstellung von Gebinden wird der verfügbare Platz, z. B. auf Paletten oder in Containern, optimal genutzt.
- Minimierung von Arbeitsaufwand: Gebinde reduzieren die Anzahl der Arbeitsvorgänge, z. B. beim Be- und Entladen von Transportmitteln.
- Reduktion von Transportrisiken: Gebinde schützen Waren vor mechanischen Schäden und Witterungseinflüssen.
- Technologische Unterstützung: Die Berechnung und Optimierung von Gebinden können komplex sein. Hierfür kommen oft spezielle Softwarelösungen wie "PUZZLE" des Fraunhofer-Instituts zum Einsatz. Diese Tools helfen dabei, die Beladung von Kartons und Paletten effizient zu planen und den verfügbaren Raum optimal zu nutzen.
Fazit: Gebinde als Schlüssel zur Logistikeffizienz
Gebinde sind in der Logistik unverzichtbar, da sie den Transport und die Lagerung von Waren erheblich vereinfachen. Sie ermöglichen eine effizientere Handhabung, reduzieren Transportrisiken und sorgen für mehr Übersichtlichkeit in den Prozessen. Unabhängig davon, ob es sich um Kleingebinde wie Getränkekisten oder Großgebinde wie Paletten handelt – der Einsatz von Gebinden trägt maßgeblich zur Optimierung der gesamten Lieferkette bei.
FAQ: Häufige Fragen zu Gebinden
Unterliegen Gebinde bestimmten Normen?
Ja, viele Gebindearten, z. B. DIN-Kegs in der Brauerei, unterliegen Normen, die ihre Abmessungen und Eigenschaften regeln.
Sind mehrere Gebinde-Ebenen immer nötig?
Nein, die Anzahl der Gebinde-Ebenen hängt von der Ware und dem Einsatzzweck ab. In manchen Fällen ist eine einzelne Ebene ausreichend.
Welche Materialien eignen sich für Gebinde?
Häufig werden Kartons aus Wellpappe oder Kunststoffverpackungen verwendet, da sie stabil und tragfähig sind. Indem Sie Ihre Gebinde sorgfältig planen und optimieren, legen Sie den Grundstein für wirtschaftliche und effiziente Logistikprozesse.
Die Art der Lieferung spielt beim Kauf von sperrigen oder schweren Waren eine entscheidende Rolle. Während kleinere Pakete oft direkt an die Haustür geliefert werden, erfolgt bei größeren Gegenständen häufig eine Lieferung frei Bordsteinkante. Doch was genau bedeutet diese Frankatur? Welche Vor- und Nachteile hat sie, und worauf sollten Sie achten, um Probleme zu vermeiden?

Was bedeutet „Lieferung frei Bordsteinkante“?
Die Lieferung frei Bordsteinkante ist eine spezielle Form der Zustellung, die häufig von Speditionen genutzt wird. Dabei wird die Ware nicht direkt ins Haus oder auf das Grundstück des Empfängers transportiert, sondern lediglich bis zur nächstgelegenen Bordsteinkante geliefert. Das bedeutet:
- „Frei“ bedeutet, dass der sichere Transport für den Empfänger kostenfrei erfolgt.
- „Bordsteinkante“ gibt an, dass der Zustellort der Gehweg, die Einfahrt oder der Straßenrand vor der angegebenen Lieferadresse ist.
Nach dem Abladen endet die Verantwortung der Spedition. Der Empfänger muss sich selbst um den Weitertransport bis zum gewünschten Einsatzort kümmern.
Warum wird die Lieferung frei Bordsteinkante genutzt?
Diese Lieferform wird aus mehreren Gründen gewählt:

1. Versicherungsgründe
Sobald die Ware auf das Grundstück oder in das Gebäude des Empfängers gebracht wird, endet häufig die Transportversicherung des Lieferanten. Falls beim Weitertransport Schäden entstehen – etwa an Wänden oder Böden –, haftet der Lieferant nicht. Um dieses Risiko zu vermeiden, endet die Zustellung bereits an der Bordsteinkante.
2. Effizienzsteigerung für Speditionen
Der Transport schwerer oder sperriger Waren ins Haus erfordert zusätzlichen Aufwand, der die Lieferzeiten verlängern kann. Durch die Lieferung frei Bordsteinkante können Speditionen mehr Waren in kürzerer Zeit ausliefern.


3. Kostenersparnis für Kunden und Händler
Da weniger Personal und Zeitaufwand benötigt werden, fallen die Lieferkosten bzw. Versandkosten niedriger aus. Dies kann sich positiv auf den Preis des Produkts auswirken.
Typische Produkte für die Lieferung frei Bordsteinkante
Diese Lieferart wird vor allem bei sperrigen oder schweren Produkten angewendet, darunter:
- Möbel (z. B. Sofas, Schränke, Betten)
- Haushaltsgeräte (Waschmaschinen, Kühlschränke)
- Baustoffe (Steine, Ziegel, Fliesen, Holz, Sand)
- Maschinen (z. B. Fitnessgeräte, Industrieanlagen)
- Große Pflanzen (z. B. Bäume oder Hecken)
Einige dieser Produkte werden häufig bereits vormontiert geliefert, während andere in Einzelteilen ankommen. In diesen Fällen ist in der Regel eine Montageanleitung beigefügt, die Ihnen als Käufer den Zusammenbau erleichtert.
Der Ablauf einer Lieferung frei Bordsteinkante
Die Lieferung erfolgt in mehreren Schritten:
- Bestellung und Bestätigung: Nach dem Kauf erhalten Sie eine Bestellbestätigung mit den Lieferkonditionen.
- Terminvereinbarung: Die Spedition kontaktiert Sie, um einen Liefertermin zu vereinbaren. In der Regel wird ein Zeitfenster genannt.
- Anlieferung: Am vereinbarten Termin wird die Ware an der Bordsteinkante abgeladen. Die Spedition informiert Sie meist kurz vorher telefonisch.
- Übergabe: Sie bestätigen den Empfang der Ware mit einer Unterschrift.
- Eigene Weiterbeförderung: Nach der Übergabe liegt es in Ihrer Verantwortung, die Ware an den gewünschten Ort zu transportieren. Schäden, die dabei entstehen, müssen Sie selbst tragen.
Wichtig: Falls Sie den Liefertermin nicht einhalten oder die Ware nicht rechtzeitig entfernen, kann sie als Hindernis im öffentlichen Raum gelten und ein Bußgeld nach sich ziehen.
Rechtliche Aspekte der Lieferung frei Bordsteinkante
Ob eine Lieferung frei Bordsteinkante oder frei Haus erfolgt, wird im Kaufvertrag geregelt. Rechtlich gibt es dabei Unterschiede zwischen Privatkunden (B2C) und Unternehmen (B2B).
B2C (Business to Customer): Lieferungen an Privatpersonen
Privatkunden sind oft nicht mit dem Begriff „frei Bordsteinkante“ vertraut. Laut aktueller Rechtsprechung muss diese Frankatur deutlich erkennbar im Kaufvertrag erwähnt und erklärt werden. Eine versteckte Klausel im Kleingedruckten reicht nicht aus.
Falls ein Käufer nicht über die Lieferbedingungen informiert wurde, hat er laut einem Urteil des Amtsgerichts Bonn (25.03.2010) das Recht, die Annahme zu verweigern. Wer dann die Kosten der Rücksendung trägt, ist oft strittig.


B2B (Business to Business): Lieferungen an Unternehmen
Bei Geschäftskunden gelten die Regelungen nach §346 des Handelsgesetzbuchs (HGB):
„Unter Kaufleuten ist in Ansehung der Bedeutung und Wirkung von Handlungen und Unterlassungen auf die im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche Rücksicht zu nehmen.”
Da Unternehmen üblicherweise mit Frankaturen vertraut sind, wird erwartet, dass sie den Weitertransport selbst organisieren können.
Vor- und Nachteile der Lieferung frei Bordsteinkante
Wie bei jedem Liefermodell hat die Lieferung frei Bordsteinkante einige Vor- und Nachteile, die Sie kennen sollten, bevor Sie die unterschiedlichen Optionen als Käufer oder als Verkäufer nutzen.
Vorteile:
- Geringere Kosten für Käufer und Verkäufer
- Schnellere Lieferung durch Zeitersparnis für die Spedition und deren Lieferanten
- Zeit und Arbeitskräfte können besser kalkuliert werden
- Klare Haftungsabgrenzung für Transportunternehmen


Nachteile:
- Der Empfänger muss den Weitertransport selbst organisieren
- Privatkunden können Schwierigkeiten beim Transport haben
- Wetterbedingungen können Schäden an der Ware verursache
- Kein Versicherungsschutz für freiwillige Weitertransporte durch Spediteure
- Für Großstädte oder Innenstädte ist das Modell eher weniger geeignet
Beispiel: Falls Spediteure gegen Trinkgeld die Ware doch ins Haus tragen, entfällt ihr Versicherungsschutz. Im Schadensfall müssen sie selbst haften.
Zentrale Bedeutung des Liefertermins
Für eine reibungslose Lieferung frei Bordsteinkante spielt vor allem der Liefertermin eine entscheidende Rolle.
- Zunächst erhalten Sie einen Lieferzeitraum, innerhalb dessen die Zustellung erfolgt.
- Anschließend gibt der Transporteur einen konkreten Termin an, idealerweise mit ausreichend Vorlauf, sodass Sie sich darauf vorbereiten können.
- Falls erforderlich, sollten Sie Helfer oder Hilfsmittel (z. B. eine Sackkarre) organisieren, um den Weitertransport problemlos zu bewältigen.
Mögliche Konsequenzen bei Problemen mit dem Liefertermin
Falls der Liefertermin nicht eindeutig kommuniziert wird oder die Ware unerwartet früh oder spät ankommt, kann das zu Problemen führen:
- Juristische Folgen: Ware, die länger als nötig im öffentlichen Raum steht, gilt als Hindernis und kann ein Bußgeld nach sich ziehen. Falls Sie die Annahme verweigern, weil der Liefertermin nicht wie vereinbart eingehalten wurde, kann es zu Diskussionen über die Rücksendekosten kommen.
- Unangenehme Situationen mit Nachbarn: Falls große oder sperrige Gegenstände den Gehweg oder den Hauseingang blockieren, kann das zu Beschwerden führen.
- Witterungsschäden: Witterungseinflüsse wie Regen, Schnee, starke Hitze oder Frost können empfindlichen Produkten erheblichen Schaden zufügen. Besonders betroffen sind Elektrogeräte oder empfindliche Materialien wie Holz oder Wellpappe-Kartons.
Alternative Lieferarten im Vergleich
| Lieferart | Beschreibung | Geeignet für |
| Frei Haus | Lieferung bis zur Haustür | Pakete, kleine Möbel |
| Frei Bordsteinkante | Lieferung bis zum Gehweg | Sperrige Güter, Maschinen |
| Frei Verwendungsstelle | Lieferung an einen vorher festgelegten Ort (z. B. Wohnzimmer) | Schwere Möbel, Baustoffe |
Fazit
Die Lieferung frei Bordsteinkante ist eine verbreitete Versandmethode für große und sperrige Waren. Sie ermöglicht eine kostengünstige und effiziente Zustellung, stellt den Empfänger jedoch vor die Herausforderung, die Ware selbst weiter zu transportieren.
Daher ist es wichtig, sich im Voraus über die Lieferbedingungen zu informieren und gegebenenfalls Helfer oder Hilfsmittel zu organisieren. Falls Sie den Komfort einer Lieferung direkt in die Wohnung oder an eine bestimmte Verwendungsstelle wünschen, lohnt es sich, mit dem Händler über alternative Lieferoptionen zu sprechen.
FAQ
Häufige Fragen zur Lieferung frei Bordsteinkante
- Was bedeutet „Lieferung frei Bordsteinkante“ genau?
Die Ware wird bis zum nächstgelegenen Gehweg, die Einfahrt oder die Bordsteinkante der angegebenen Lieferadresse transportiert. Der Empfänger muss den Weitertransport selbst organisieren.
- Wie erkenne ich, ob meine Bestellung frei Bordsteinkante geliefert wird?
Diese Information finden Sie in der Produktbeschreibung, den Versandbedingungen oder den AGB des Verkäufers. Im Zweifel lohnt es sich, vorab beim Händler oder der Spedition nachzufragen.
- Muss ich beim Liefertermin anwesend sein?
Ja, in den meisten Fällen. Sie müssen den Erhalt der Ware bestätigen und sich um den weiteren Transport kümmern. Falls Sie verhindert sind, sollten Sie eine Vertrauensperson beauftragen oder mit der Spedition eine alternative Lösung abklären.
- Was passiert, wenn ich die Ware nicht rechtzeitig von der Bordsteinkante entferne?
Die Ware gilt als Hindernis im öffentlichen Raum. Das kann zu Bußgeldern führen oder dazu, dass die Spedition die Lieferung als nicht zustellbar betrachtet. In diesem Fall könnten zusätzliche Kosten für eine erneute Zustellung oder Lagerung entstehen.
- Kann ich gegen Trinkgeld die Ware bis in meine Wohnung bringen lassen?
In der Regel nicht. Die Speditionsmitarbeiter sind dazu angewiesen, die Ware nur bis zur Bordsteinkante zu liefern. Eine spontane Zusatzleistung ist nicht versichert, sodass bei Schäden weder der Spediteur noch der Händler haftet.

Was versteht man unter GHS?
Das Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) ist ein weltweit einheitliches System zur Einstufung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe und Gemische. Es bildet die Grundlage für viele nationale Regelungen, darunter auch die deutsche Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). In der Europäischen Union (EU) wird das GHS durch die CLP-Verordnung (Classification, Labelling and Packaging) umgesetzt, die eine einheitliche Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien sicherstellt.
Ziel des GHS ist es, international bestehende Unterschiede in der Klassifizierung von Chemikalien aufzuheben und gleichzeitig die Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sowie den sicheren Transport gefährlicher Stoffe weiter zu verbessern.
Gefahrstoffe finden sich in zahlreichen Wirtschaftsbranchen, darunter die Metallverarbeitung, die chemische Industrie und das Bauwesen. Aber auch das Gesundheitswesen, beispielsweise beim Kennzeichnen von Arzneimitteln, sowie die Kosmetikbranche setzen auf GHS-konforme Kennzeichnung.
Die Bedeutung von Gefahrstoffetiketten
Die Kennzeichnung von Chemikalien mit GHS-Etiketten ist ein wesentlicher Bestandteil des Arbeitsschutzes. Sie informiert über Gefahren und Sicherheitsmaßnahmen und trägt dazu bei, Risiken im Umgang mit gefährlichen Stoffen zu minimieren.
- Arbeitgeber und Arbeitnehmer: GHS-Etiketten helfen, notwendige Unterweisungen, Belehrungen und Sicherheitsmaßnahmen vor dem Umgang mit einem Produkt zu erkennen. In Bereichen wie Logistik, Transport und Montage erleichtern sie zudem das sichere Lagern, Transportieren und Entsorgen gefährlicher Stoffe.
- Ersthelfer und Rettungskräfte: Im Notfall ermöglichen GHS-Etiketten eine schnelle Einschätzung möglicher Gesundheits- oder Umweltschäden. Selbst Unfallzeugen können durch die Kennzeichnung wichtige Informationen an den Rettungsdienst weitergeben.
- Endverbraucher: GHS-Etiketten sensibilisieren für mögliche Gefahren und helfen dabei, Risiken zu minimieren – sei es durch das sichere Aufbewahren bestimmter Produkte, die korrekte Entsorgung oder den Schutz vor Hautkontakt.


Ergänzende Sicherheitsmaßnahmen: Sicherheitsdatenblätter
Neben der Kennzeichnung von Chemikalien mit GHS-Etiketten ist auch die Standardisierung von Sicherheitsdatenblättern ein wichtiger Bestandteil des Systems. Diese Datenblätter enthalten detaillierte Informationen über:
- Eigenschaften der Chemikalien
- Sichere Handhabung und Lagerung
- Maßnahmen im Notfall (z. B. Erste Hilfe, Brandbekämpfung, Leckagenkontrolle)
Durch diese Standardisierung wird nicht nur der internationale Handel mit Chemikalien erleichtert, sondern auch ein hohes Schutzniveau für Gesundheit und Umwelt sichergestellt.
Kennzeichnung von Gefahrstoffen
Alle Gefahrstoffe werden nach einem festgelegten Schema auf Etiketten und Unterlagen gekennzeichnet:
- Eine rote Raute (ein auf der Spitze stehendes Quadrat) mit weißem Innenteil, in dem sich eines von neun festgelegten Symbolen befindet.
- Ein GHS-Code, bestehend aus den Buchstaben "GHS" und einer Zahl zwischen 01 und 09.
- Ein H-Code (Hazard Statement), der mit "H" beginnt, gefolgt von zwei bis vier Ziffern, die die genaue Art der Gefahr beschreiben.
- Ein Signalwort in der jeweiligen Landessprache.
- Detaillierte Sicherheitsinformationen, darunter Angaben zur genauen Zusammensetzung, möglichen Gefahren, empfohlenen Gegenmaßnahmen sowie die Kontaktinformationen des Inverkehrbringers.
Diese Elemente zusammen bilden das GHS-Piktogramm. Ein ähnliches System wird auch bei Gefahrgütern verwendet: Während sich die neun Gefahrgutklassen auf dieselben Symbole stützen, werden sie durch unterschiedliche Farben weiter differenziert, um eine schnellere Identifikation zu ermöglichen.

Was bedeuten die GHS-Symbole?
Die Gefahrstoffverordnung nennt insgesamt 28 unterschiedliche Gefahrstoffe – dabei steht jedes der neun GHS-Piktogramme für mehrere Gefahrenklassen. Es kommt auf den genauen Gefahrstoff an, ob sich auf seiner Gefahrstoffkennzeichnung lediglich eines oder mehrere dieser Symbole befinden.
| Symbol | Beschreibung | Gefahrenklasse | GHS-Code | Signalwort |
 | Explodierende Bombe | Explosive Stoffe / Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff. Teilweise selbstzersetzliche Stoffe / Gemische. Teilweise organische Peroxide. | GHS01 | Gefahr |
 | Flamme über Strich | Entzündbare Gase / Flüssigkeiten / Aerosole / Feststoffe. Pyrophore Flüssigkeiten / Feststoffe. Teilweise selbstzersetzliche Stoffe / Gemische. Selbsterhitzungsfähige Stoffe / Gemische. Brennbare Gase bei Wasserkontakt entwickelnde Stoffe / Gemische. Teilweise organische Peroxide. | GHS02 | Je nach genauer Art Gefahr oder Achtung |
 | Flamme über Kreis | Oxidierende Gase / Flüssigkeiten / Feststoffe | GHS03 | Gefahr |
 | Gasflasche | Verdichtete / Verflüssigte / Tiefgekühlte verflüssigte / Gelöste Gase | GHS04 | Achtung |
 | Zwei Reagenzgläser, darunter geschädigte Oberfläche und Hand -> Ätzwirkung | Gegenüber Metall korrosive Stoffe / Gemische. Haut / Augen reizende / schädigende Stoffe / Gemische | GHS05 | Je nach genauer Art Gefahr oder Achtung |
 | Totenkopf mit darunter gekreuzten Knochen | Akut toxische Stoffe / Gemische Codes 1 bis 3 | GHS06 | Gefahr |
 | Ausrufezeichen | Akut toxische Stoffe / Gemische Code 4. Haut reizende Stoffe / Gemische Code 2. Haut Sensibilisierende Stoffe / Gemische. Zielorgan-toxische Stoffe / Gemische Code SE3 (einmalige Exposition). Ozonschichtschädigende Stoffe / Gemische | GHS07 | Achtung |
 | Menschlicher Torso | Atemwegssensibilisierende Stoffe / Gemische. Keimzellenmutagene / Reproduktionstoxische / Karzinogene Stoffe / Gemische. Zielorgan-toxische Stoffe / Gemische Codes SE1, SE2 (einmalige Exposition). Zielorgan-toxische Stoffe / Gemische Codes RE1, RE2 (wiederholte Exposition). Aspirationsgefährliche Stoffe / Gemische | GHS08 | Je nach genauer Art Gefahr oder Achtung |
 | Abgestorbener Baum und toter Fisch | Akut / Chronisch gewässergefährdende Stoffe / Gemische / Erzeugnisse | GHS09 | Je nach genauer Art Achtung oder kein Signalwort |

Der UFI-Code im GHS
Mit der EU-Verordnung 2017/542 wurden im Jahr 2017 weitere Änderungen eingeführt. Seitdem müssen GHS-Aufkleber zusätzlich den UFI-Code (Unique Formula Identifier, deutsch: eindeutiger Rezepturidentifikator) enthalten.
Der UFI-Code ist eine 16-stellige Kombination aus Buchstaben und Zahlen, die einen Gefahrstoff eindeutig identifiziert. Dies erleichtert insbesondere die Kommunikation mit Giftnotrufzentralen, da der Code schnelle Informationen zu Handelsnamen, Zusammensetzung, Farbe und Toxikologie liefert.
Was ist der Unterschied zwischen GHS und CLP?
Die CLP-Verordnung (Verordnung Nr. 1272/2008) wurde 2008 in der EU eingeführt und stellt die direkte Umsetzung des Globally Harmonised System (GHS) dar. Sie enthält Richtlinien zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Gefahrstoffen, um den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu gewährleisten.
Neben einheitlichen Kennzeichnungselementen wie Piktogrammen und Standardtexten für GHS-Etiketten legt die CLP-Verordnung auch Verpackungsstandards für verschiedene Arten von Gefahrstoffen fest. Darüber hinaus verpflichtet sie Importeure und nachgeschaltete Anwender, Informationen über physikalisch und gesundheitlich schädliche Gemische an die zuständigen Behörden weiterzuleiten.
Zusätzlich fördert die CLP-Verordnung Wettbewerbsfähigkeit und Innovation und erleichtert den freien Handel chemischer Substanzen und Gemische innerhalb der EU durch einheitliche Regelungen. Die CLP-Verordnung basiert dabei auch auf früheren EU-Richtlinien, darunter:
- Richtlinie 67/548/EWG (Gefährliche-Stoffe-Richtlinie)
- Richtlinie 1999/45/EG (Gefährliche-Zubereitungen-Richtlinie)
Mit der Einführung der CLP-Verordnung wurden diese Richtlinien ersetzt, um eine einheitliche und modernisierte Grundlage für die Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien in der EU zu schaffen. Dies erleichtert nicht nur den internationalen Handel, sondern gewährleistet auch ein höheres Schutzniveau für Mensch und Umwelt.

1992 wurde auf dem Weltgipfel für Nachhaltigkeit die Idee eines global einheitlichen Systems zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien vorgestellt. Daraus entstand 2002 das Globally Harmonised System (GHS), das einheitliche Gefahrensymbole, Labels und Sicherheitsdatenblätter standardisiert.
In der EU wurde das GHS durch die CLP-Verordnung (2008) umgesetzt, die 2009 in Kraft trat und bis 2015 nationale Vorschriften ersetzte. Seitdem gelten europaweit einheitliche Regeln zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung gefährlicher Stoffe und Gemische.
Was sind Gefahrstoffe?
Gefahrstoffe können aufgrund ihrer chemischen oder physikalischen Eigenschaften problematisch sein – insbesondere bei unsachgemäßem Umgang. Sie lassen sich in drei Hauptgruppen einteilen:
- Reinstoffe: Einzelne chemische Elemente (z. B. Wasserstoff, H) oder Verbindungen aus mindestens zwei Elementen (z. B. Wasser, H₂O)
- Gemische: Kombinationen aus mindestens zwei Reinstoffen, die unterschiedliche Formen wie Rauch oder Emulsionen annehmen können
- Erzeugnisse: Hier stehen die technischen Eigenschaften im Vordergrund. Während Kugelschreiber nach EU-Gesetzgebung als Gemische gelten, werden Batterien als Erzeugnisse klassifiziert
Gefahrstoffe können gesundheitliche, physikalische oder umweltgefährdende Eigenschaften aufweisen – sei es durch Brennbarkeit, Explosionsgefahr oder schädliche Auswirkungen auf Lebewesen und Materialien. Entscheidend ist dabei nicht nur der Grundzustand, sondern auch mögliche Gefahren während der Herstellung oder Nutzung.

Zum besseren Verständnis werden die Begriffe „Gefahrstoffe“ und „Stoffe“ im weiteren Verlauf allgemein verwendet. Eine detaillierte Unterscheidung zwischen Reinstoffen, Gemischen und Erzeugnissen erfolgt nur, wenn es für die sachliche Richtigkeit erforderlich ist. Gefahrstoffe können über verschiedene Wege in den menschlichen Körper gelangen:
- Inhalative Exposition: Einatmen von Gasen, Dämpfen, Nebel oder Staub.
- Dermale Exposition: Aufnahme über die Haut oder die Schleimhäute durch direkten Kontakt.
Je nach Expositionsweg kann sich das gesundheitliche Risiko unterscheiden, weshalb entsprechende Schutzmaßnahmen (z. B. Atemschutz, Handschuhe) erforderlich sind.
Beispiele für Gefahrstoffe
Bereits die Definition eines Gefahrstoffs macht deutlich, dass darunter eine Vielzahl unterschiedlicher Eigenschaften fallen. Die wichtigste rechtliche Grundlage in Deutschland ist die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Sie legt alle Vorgaben zur Gefahrstoffkennzeichnung mit Chemieetiketten oder GHS-Etiketten sowie zur rechtskonformen Verpackung fest.
In §3 der Gefahrstoffverordnung werden vier Hauptarten von Gefahren definiert, denen jeweils verschiedene Eigenschaften der Gefahrstoffe zugeordnet sind. Insgesamt listet das Gesetz 28 spezifische Gefährdungsmerkmale auf. Zusätzlich unterscheidet die GefStoffV folgende Kategorien von Gefahrstoffen:
- Chemikalien, die konkret in §3 GefStoffV aufgelistet sind,
- Substanzen mit explosionsfähigen Eigenschaften,
- Produkte, bei deren Herstellung oder Verwendung gefährliche Stoffe entstehen können,
- Materialien, die zwar nicht als Gefahrstoffe gelten, aber arbeitsschutzrelevant sind,
- Chemikalien mit einem festgelegten Arbeitsplatzgrenzwert.


Gefahrenklassen nach der GefStoffV
Die Gefahrstoffverordnung unterscheidet Gefahrstoffe nach ihren Gefahrenklassen:
- Physikalische Gefahren (z. B. entzündbare, explosive oder selbstzersetzliche Stoffe)
- Gesundheitsgefahren (z. B. krebserzeugende, giftige oder ätzende Stoffe)
- Umweltgefahren (z. B. gewässergefährdende Stoffe)
Diese Klassifizierung bestimmt, welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind und welche Kennzeichnungen auf Verpackungen und Sicherheitsdatenblättern vorgeschrieben sind.
Rechtsfolgen bei Verstößen gegen die GefStoffV
Die Gefahrstoffverordnung enthält klare Regelungen für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen. Verstöße können je nach Schwere als Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten geahndet werden. Dies betrifft beispielsweise:
- Fehlende oder fehlerhafte Kennzeichnung von Gefahrstoffen,
- Unzureichende Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmer,
- Nichteinhaltung von Lager- und Transportvorschriften,
- Missachtung von Arbeitsplatzgrenzwerten für gefährliche Stoffe.
Die konsequente Einhaltung der Gefahrstoffverordnung dient nicht nur der rechtlichen Sicherheit, sondern schützt auch Mensch und Umwelt vor potenziellen Gefahren.


Gibt es Unterschiede zwischen Gefahrstoff und Gefahrgut?
Wer sich mit Gefahrstoffsymbolen und der Kennzeichnung von Gefahrstoffen beschäftigt, stößt unweigerlich auf den Begriff Gefahrgut. Trotz der Ähnlichkeit unterscheiden sich beide Begriffe deutlich:
- Gefahrstoffe: Diese stellen eine Gefahr bei Herstellung, Lagerung oder Verwendung dar.
- Gefahrgut: Dies sind Stoffe, die während des Transports eine Gefahr darstellen.
Das bedeutet: Nicht jeder Gefahrstoff ist automatisch ein Gefahrgut, kann es aber werden – etwa, wenn ein LKW große Mengen Feuerzeugbenzin transportiert. Umgekehrt gibt es Gefahrgüter, die keine Gefahrstoffe sind, wie zum Beispiel Lithium-Ionen-Akkus im Lufttransport.

"Eine Welt ohne Etiketten? Für mich unvorstellbar!"
Sie haben Fragen zu unseren Etiketten?
Ich helfe Ihnen gerne persönlich weiter.
Labelprint24 - vielseitige Etiketten für Ihre Produkte!
Die Auswirkungen der GHS-Verordnung auf Verpackungen
Die CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) regelt die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung gefährlicher Stoffe und Gemische innerhalb der Europäischen Union. Sie betrifft alle Verpackungen, die für die direkte Nutzung eines Produkts erforderlich sind oder diese vorbereiten, einschließlich äußerer, innerer und Zwischenverpackungen. In diesen Fällen sind GHS-Aufkleber (Globally Harmonized System) verpflichtend anzubringen.
Schutz- und Konsolidierungsverpackungen, die ausschließlich dem Transport oder der Lagerung dienen, fallen hingegen nicht unter die Kennzeichnungspflicht der CLP-Verordnung. Das bedeutet beispielsweise:
- Direkte Umverpackung (Sekundärverpackung): Eine Batterie, die als gefährlicher Stoff eingestuft ist, muss in ihrer direkten Umverpackung mit den entsprechenden Gefahrstoffetiketten versehen werden.
- Transportverpackung: Ein Pappkarton, der mehrere solcher Batterieverpackungen für den Transport zusammenfasst, gilt als Schutzverpackung und unterliegt nicht den CLP-Kennzeichnungsvorschriften.
Weitere Verpackungsvorgaben nach der CLP-Verordnung:
- Verpackungsgröße: Kleingebinde unter 125 ml können unter vereinfachten Kennzeichnungspflichten fallen, in denen nicht alle Gefahrhinweise erforderlich sind.
- Pflichten der Inverkehrbringer: Hersteller, Importeure und Händler müssen sicherstellen, dass ihre Verpackungen rechtzeitig und korrekt gekennzeichnet sind.
- Mehrsprachige Kennzeichnung: Gefahrstoffetiketten müssen in der Amtssprache des Mitgliedstaates vorliegen, in dem das Produkt verkauft wird.
- Sicherheitsanforderungen: Für bestimmte Stoffe sind kindergesicherte Verschlüsse und tastbare Warnzeichen vorgeschrieben, um Verbraucher besser zu schützen.

Da nicht alle Verpackungsarten von diesen Vorschriften betroffen sind, muss die Verpackungsindustrie keine vollständige Umstellung ihrer Prozesse vornehmen. Dennoch ist es essenziell, sich mit den aktuellen Richtlinien vertraut zu machen. Unternehmen in der Verpackungsbranche sind gemäß CLP-Verordnung verpflichtet, durch angemessene Gefahrstoffetiketten einen transparenten Informationsfluss mit ihren Kunden sicherzustellen.
Eine rechtzeitige Überprüfung, ob und in welchem Umfang die eigenen Verpackungen den Vorschriften unterliegen, ist daher unerlässlich.